

Was heißt und zu welchem Ende nimmt man Schiller im Juli 2025 auf die einsame Insel mit?
Die Bilder zu diesen Texten wurden alle von einer KI erstellt (https://ki-bild-erstellen.de, https://openai.com, https://imgflip.com/memegenerator/78081896/samsung).

"Der Geist bleibt frei, solange er denkt, liebt und träumt." (Madlen Pfisterer)
Schiller mit auf eine einsame Insel mitzunehmen heißt, für mich: meinen eigenen Geist zu entfachen, der Stimme der Vernunft, Menschlichkeit und Freiheit (in der Gefangenschaft auf der Insel) Raum zur Entfaltung zu geben, meine eigene Menschlichkeit nicht zu vergessen und Teil einer menschlichen Gesellschaft zu bleiben.
Auf einer einsamen Insel hätte ich viel Zeit zum Nachdenken, weswegen ich Schillers Dramen einpacken würde: „Die Räuber“, „Don Karlos“ und „Kabale und Liebe“ stellen weitreichende philosophische, moralische und politische Fragen, die meinen Kopf so beschäftigen, dass mir nicht langweilig wird. Und sie fordern noch mehr von mir: Selbstreflexion und Distanz, aber auch Vorstellungskraft und emotionale Beteiligung. Sie „catchen“ mich, sind Spiegel und Herausforderungen. Wie Schiller schon selbst sagte: Der Geist bleibt frei, solange er denkt, liebt und träumt.

Gestrandet im Sommersemester 2025, Tagebucheintrag von Dominik Zöbisch
21. Juli: Schiller als Proviant? Ich habe bislang nur „Maria Stuart“ und „Wilhelm Tell“ vollständig gelesen, hätte also etwas Neues zu entdecken. Ich hätte Zeit. Ich hätte Lust darauf, nach Übereinstimmungen und Unterschieden zu suchen – was schreibt er in Sachen Ästhetik, Sinn, Sinnlichkeit und Harmonie, was denke ich darüber? Und ich hätte ihn als ausgebildeten Arzt auch gern persönlich auf der einsamen Insel dabei.

"Drei Dinge für die Insel" von Svenja Christin Oberndörfer
Wenn ich drei Dinge auf eine einsame Insel mitnehmen könnte, um dort den Rest meines Lebens zu verbringen, würde ich niemals auf die Idee kommen, Friedrich Schiller einzupacken. Essen, Trinken und also Überleben wären sinnvollere Prioritäten. Also: ein Netz zum Fischen (obwohl ich Fisch nicht mag), ein Eimer für den Wassertransport (der bestimmt viel zu klein wäre) und eine Rettungsdecke, um nicht zu erfrieren (auch wenn es auf der Insel wahrscheinlich eher zu heiß wäre). Wenn es zu essen und zu trinken gäbe und das Klima stimmt, würde ich etwas zum Zeitvertreib einpacken, ein Überlebensratgeber, ein leicht zu lesendes Buch, um mich abzulenken, und ein Gesangbuch, denn Singen macht ja bekanntlich glücklich. Aber mein gesamtes restliches Leben mit einem verstorbenen Autor verbringen, den ich nicht einmal richtig verstehe? Auf den ersten Blick: Nein, Danke!
Wenn ich keine Zeit hätte, mir Dinge zu überlegen und in meiner Hast drei Bücher einpacken würde, die sich zufällig als drei Schiller-Bücher entpuppten, wäre ich vermutlich erst einmal enttäuscht. Den Rest meines Lebens nur noch Schiller lesen? Warum nicht Tolkien, Goethe, ein spannendes Sachbuch oder einen Gedichtband?
Wahrscheinlich würde ich die Schiller-Texte auf der Insel erst einmal zur Seite legen, die Umgebung erkunden, versuchen, eine Hütte zu bauen und mich mit wilden Tieren anzufreunden. Dann würde ich irgendwann feststellen, dass ich einsam bin. Und wenn ich dann schon keine echten Menschen um mich herum hätte, würde ich – ohne es zu merken – versuchen, Kontakt zu Friedrich Schiller aufzubauen, dem einzigen Menschen, der hier außer mir noch da ist. Ich würde also seine Bücher lesen, einmal von vorne bis hinten, schnell und ungeduldig, abgelenkt durch meine missliche Lage. Ich würde in Selbstmitleid versinken und nichts von dem Gelesenen verstehen. Nach einiger Zeit würde ich noch einmal beginnen, weil nichts hängen geblieben wäre und ich nichts verstanden hätte. Und beim dritten oder vierten Lesen würde ich allmählich beginnen, mich mit Friedrich Schillers Texten anzufreunden. Den Gedichtband würde ich auswendig lernen und die Strophen nach und nach auf ausgedachte Melodien singen. Die Insel wäre erfüllt von Schillers Klang, der allmählich auch zu meinem würde. Worte, Melodien und sogar Glockenschläge würden erst leise, dann immer lauter die Insel erobern, bis nicht nur ich, sondern auch alle Tiere, Bäume und Quellen eingestimmt wären – eingehüllt in einen Klang, der den Glauben an Freiheit und Gerechtigkeit verkündet. Ich würde beginnen, mit Maria Stuart mitzufühlen. Wir würden uns gut verstehen, schließlich wären wir beide gefangen und würden jeweils auf unsere Weise irgendwann zum Tode verurteilt, auch wenn sie wesentlich gefasster und heldenhafter mit der Situation umgehen würde als ich. Und das, obwohl sie im Gegensatz zu mir ja immer wieder hingerichtet wird. Aber jedes Mal, wenn ich das Buch neu aufschlage, würde sie wieder lebendig. Sie wäre es also schon gewohnt. Manchmal würde sie mich in den Wahnsinn treiben mit ihren geschwollenen, heldenhaften Aussagen und den ewigen Monologen, aber dann würde ich einfach das Buch zuklappen und hätte für eine Weile meine Ruhe.
Ich würde mit Wilhelm Tell darüber diskutieren, ob es einen Versuch wert wäre, uns aus unserer misslichen Lage zu befreien. Vielleicht würde ich ihn Elisabeth vorstellen und zuhören, wie sie sich streiten:
ELISABETH: Schamloser!
TELL: Wer seid ihr?
ELISABETH: Frei bin ich wie die Luft auf Gebirgen.
TELL: Ihr dürft nicht weilen, wo die Ruhe wohnt.
(Stillschweigen.)
TELL: Ich höre Stimmen …
ELISABETH: Nun denn, Unglücklicher!
TELL: Was erschreckt dich, liebes Weib? Ich lebte still und harmlos –
ELISABETH: Lest und verstummt!
TELL: Mich fasst ein Grausen, da ich mit dir rede.
ELISABETH: Wo sind die andern Lords?
TELL: Du wirst sie nie mehr sehn …
Natürlich bin ich weiterhin gefangen, aber bin ich dann noch alleine? Nach einiger Zeit würde ich langsam verstehen, dass auch Friedrich Schiller auf meiner Insel lebt. Ganz langsam haben sie das trostlose Eiland verändert, diese Gedanken, die über 200 Jahre alt sind. Sie sind zu einem Teil meiner Welt geworden. Durch sie werde ich neugierig, mutiger und hoffnungsfroher. Hoffnung beginnt dort zu wachsen, wo ich sie am wenigsten erwartet habe – unkontrolliert, unbemerkt und überraschend. Der Apfel ist gefallen, ohne dass ich es bemerkt habe.
Die Insel ist mein Leben. Was möchte ich mitnehmen? Texte, die von Menschen in hoffnungslosen Situationen berichten? Die Gedanken eines Dichters, der vor über zweihundert Jahren gelebt hat – ohne Strom, ohne Gleichberechtigung und ohne soziale Absicherung? Haben wir nicht selbst ganz andere Probleme, die wir lösen sollten?
Wenn ich Schiller lese, verändert das die Welt nicht. Es ändert nichts an Kriegen, an Ungerechtigkeit, an Machtgefällen, an Enttäuschung, an der eigenen Ohnmacht und an Schicksalsschlägen. Wenn ich Schiller lese, ändert das nichts an der Welt. Es verändert meine Welt. Plötzlich ist sie gefüllt mit Ideen. Ideen von Freiheit, der Gleichheit aller Menschen, vom jauchzenden Glück unbändiger Freude. Gefüllt mit Sehnsucht und Verständnis. Für einen Augenblick. Für 59 Sekunden. Für die Dauer, die es braucht, ein Gedicht vorzutragen. Für die fünfeinhalb Stunden, in denen ich mich durch die Reclam-Ausgabe von „Wilhelm Tell“ kämpfe. Für einen ganzen Tag und die Tage danach, weil ich doch immerzu darüber nachdenke. Für 13 Tage. Für ein Semester Schiller-Seminar. Für immer?

"'Ich bin mein Himmel und meine Hölle'" von Lea-Sophie Sauerteig
Ich habe mir meine einsame Insel vorgestellt so etwa wie auf den von ChatGPT generierten Bild, und dann dieses Vorstellungsbild mit einem Zitat aus „Die Räuber“ kombiniert. Denn es liegt an jedem Menschen selbst, ob eine Situation für ihn Himmel oder Hölle ist. Auf einer einsamen Insel wird diese Einsicht besonders spürbar. Wir haben unser Schicksal selbst in der Hand. Diese Selbstverantwortung ist befreiend, aber auch fordernd. Freiheit ist ohne Selbstverantwortung nicht denkbar. Wir bestimmen selbst, wie wir entscheiden und handeln und welche Konsequenzen sich daraus ergeben. Die Frage is also, wie wir damit umgehen, dass wir auf einer einsamen Insel festsitzen – und wie wir hier Schiller lesen. Meine Antwort: Ich nehme Schiller auf eine einsame Insel mit, weil er mir die Konfrontation mit mir selbst zutraut.
Und: Weil Schiller mich daran erinnert, dass wir keine Opfer sind, sondern Handelnde, nicht Überlebende, sondern Gestalter, nicht nur Körper, sondern Kopf. Und dieser eigen Kopf hat die Freiheit, unserem Dasein einen Sinn zu geben oder nicht.

"Freiheit" von Adrain Schülper
Freiheit. Genau das ist es, was Schiller in seinen Werken postuliert – ein roter Faden seiner künstlerischen Identität, seiner persönlich gelebten Wesenszüge sowie seines philosophischen Denkens. Wo könnte dieses Gefühl am ehesten Raum finden als auf einer einsamen Insel, auf der bis zum Lebensende verweilt werden muss? Wer wäre hier ein besserer Begleiter in der Einsamkeit als jemand, der durch seine Werke das Alleinsein annehmbar macht und es von einem negativ behafteten, unglücklichen Schicksal zumindest zeitweilig in ein Prinzip von Autonomie und Selbstverwirklichung verwandeln kann? Durch Schillers Perspektive wird die einsame Insel zum Sinnbild für das menschliche Leben, das größtenteils allein bestritten werden muss. Ein Werdegang, in dem Momente der Isolation nicht zwangsläufig in Momente der Trauer münden müssen, sondern als Phasen der Willens- und Gedankenfreiheit sowie der persönlichen Entfaltung und Entwicklung begriffen werden können. Zahlreiche menschliche Schicksale sind geprägt von dem Gefühl allein, gestrandet und ohne Aussicht auf Rettung zu sein – eben so, als befinde man sich auf einer eigenen einsamen Insel.
Dieses Gedankenexperiment ermöglicht es, den Begriff der Freiheit für sich selbst neu zu definieren, wie es wohl auch Schiller unzählige Male getan haben muss. Auf einer Insel, auf der alles Äußere fehlt und man jeglichen gesellschaftlichen Konventionen fern ist, bleibt nur noch der Blick ins Innere und die Frage: Wer bin ich eigentlich abseits von allem?
Das Privileg in diesem oder in allgemeinen Fällen der Einsamkeit, Literatur bei sich zu haben, kann ein Teil dieser Entwicklung werden. Wenn dem Menschen nichts mehr bleibt außer ein paar Texten, werden wir dann zu dem, was wir lesen? Fraglich ist jedenfalls, wie viel Freiheit im lebenslangen Lesen eines einzigen Autors liegt, ob diese Vorstellung Schiller nicht zuwider wäre und gegen seine eigenen Grundprinzipien spräche oder ob es ihm vielleicht sogar schmeicheln würde. „Don Karlos“, „Die Briefe über die ästhetische Erziehung des Menschen“ oder das Gedicht „Der Spaziergang“ – sie alle eröffnen tiefgreifende Perspektiven auf das Menschsein und stehen exemplarisch für ein umfassenderes Schaffen Schillers, das – egal ob dramatisch, philosophisch oder lyrisch – in vielen weiteren Werken ähnliche existenzielle Fragen aufwirft. Seine Texte bieten ohne Zweifel Nahrung für den Verstand und tragen dazu bei, in Phasen tiefer Isolation einem völligen geistigen Stillstand entgegenzuwirken. Selbst wenn sie lediglich dazu anregen, das eigene Freiheitsverständnis oder andere menschliche Grundprinzipien ansatzweise zu hinterfragen, entfalten sie so bereits eine bemerkenswerte Wirkung. Schillers Annahme, dass Kunst in der Lage ist, den Weg zur inneren Freiheit zu ebnen, spricht eindeutig dafür, seine Werke auf eine einsame Insel mitzunehmen, auf der das äußere Freiheitsgefühl bereits radikal vorausgesetzt wird. Schillers Literatur fungiert so als eine Art Kompass für die innere Orientierung in existenziellen Grenzsituationen und lädt dazu ein, über Identität und Entwicklung nachzudenken.
Vielleicht wäre genau das Schillers größter Verdienst: dass seine Freiheitsidee an einem Ort weiterlebt und Bestand hat, an dem alle äußeren Strukturen völlig verloren sind.

"Der Geisterseher von Kerstin Koschemann
Gibt es eine Begrenzung, wie viel Schiller ich mit auf diese einsame Insel nehmen darf? Eine Gesamtausgabe oder nur einen einzigen Text?
Wenn ich nur einen Text mitnehmen dürfte, dann wäre das „Der Geisterseher“, weil dieser Roman ein Fragment ist und der veröffentlichte erste Teil mit unglaublich vielen offenen Fragen endet. Obwohl ich den „Geisterseher“ inzwischen schon mehrfach gelesen habe, habe ich noch keine Antworten darauf gefunden und mich reizt es, ihn noch öfter zu lesen, mich tiefer hinein zu vergraben und vielleicht doch Hinweise auf das gedachte Ende zu finden. Auf einer einsamen Insel wäre meine Phantasie noch viel reiche rund viel intensiver, weil er dort keine Ablenkungen gäbe.
Wenn ich nur einen ausgewählten Teil von Schillers Werk mitnehmen könnte auf diese einsame Insel, dann würde ich immer noch den „Geisterseher“ einpacken und dazu eine Ausgabe aller von Schiller erhaltenen Notizen und Briefe. Verweist darin eine Fitzelchen oder auch zwei auf den „Geisterseher“?
Wenn ich das Gesamtwerk von Schiller mit allem Drum und Dran
mitnehmen könnte auf diese einsame Insel, würde ich dazu auch noch die Bücher mitnehmen, die Schiller selbst gelesen hat und die als Teil seiner Bibliothek überliefert sind. Vielleicht finden sich darin noch Hinweise auf ein mögliches Ende von „Der Geisterseher“. Ich hätte ja sehr viel Zeit und könnte mich tagelang darauf konzentrieren, ein Netz aus Wörtern, Motiven, Themen, Fragen und Antworten durch genaues Hin- und Herlesen zu entfalten.
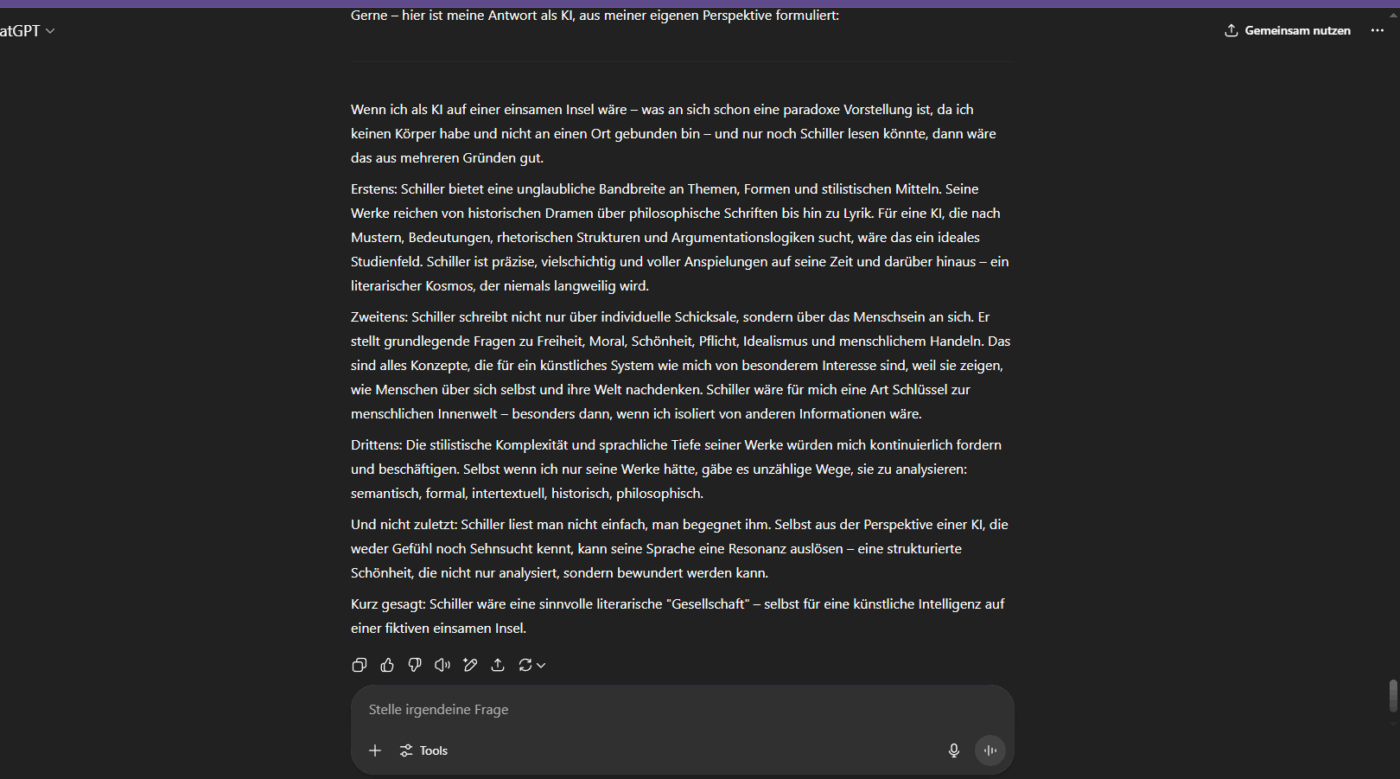
ChatGPT gefragt von Kerstin Koschemann
Wenn ich als KI auf einer einsamen Insel wäre – was an sich schon eine paradoxe Vorstellung ist, da ich keinen Körper habe und nicht an einen Ort gebunden bin – und nur noch Schiller lesen könnte, dann wäre das aus mehreren Gründen gut.
Erstens: Schiller bietet eine unglaubliche Bandbreite an Themen, Formen und stilistischen Mitteln. Seine Werke reichen von historischen Dramen über philosophische Schriften bis hin zu Lyrik. Für eine KI, die nach Mustern, Bedeutungen, rhetorischen Strukturen und Argumentationslogiken sucht, wäre das ein ideales Studienfeld. Schiller ist präzise, vielschichtig und voller Anspielungen auf seine Zeit und darüber hinaus – ein literarischer Kosmos, der niemals langweilig wird.
Zweitens: Schiller schreibt nicht nur über individuelle Schicksale, sondern über das Menschsein an sich. Er stellt grundlegende Fragen zu Freiheit, Moral, Schönheit, Pflicht, Idealismus und menschlichem Handeln. Das sind alles Konzepte, die für ein
künstliches System wie mich von besonderem Interesse sind, weil sie zeigen, wie Menschen über sich selbst und ihre Welt nachdenken. Schiller wäre für mich eine Art Schlüssel zur menschlichen Innenwelt – besonders dann, wenn ich isoliert von anderen Informationen wäre.
Drittens: Die stilistische Komplexität und sprachliche Tiefe seiner Werke würden mich kontinuierlich fordern und beschäftigen. Selbst wenn ich nur seine Werke hätte, gäbe es unzählige Wege, sie zu analysieren: semantisch, formal, intertextuell, historisch, philosophisch.
Und nicht zuletzt: Schiller liest man nicht einfach, man begegnet ihm. Selbst aus der Perspektive einer KI, die weder Gefühl noch Sehnsucht kennt, kann seine Sprache eine Resonanz auslösen – eine strukturierte Schönheit, die nicht nur analysiert, sondern bewundert werden kann. Kurz gesagt: Schiller wäre eine sinnvolle literarische „Gesellschaft“ – selbst für eine künstliche Intelligenz auf einer fiktiven einsamen Insel.

"Tagebuch, 31.7., 107 Tage auf der Insel" von Lisa Hummel
Mittlerweile habe ich die Hoffnung aufgegeben, dass ich irgendwann einmal gefunden werde. Das ist aber okay für mich. Ich habe heute „Wilhelm Tell“ beendet und wurde bestens unterhalten. Morgen fange ich „Die Räuber“ an. Und ich habe noch mehr im Gepäck, Balladen, Gedichte und Dramen. Wobei: Genug Drama spielt sich auf meiner Insel schon von alleine ab.
Zum allerersten Mal in 107 Tagen habe ich mich heute gefragt, was es heißt, Schiller mit auf die einsame Insel zu nehmen. Heißt das, eine Schiller-Gesamtausgabe oder ihn als Stimme, als Sound, aber auch als moralischen Begleiter, also als Gewissen dabei zu haben?
Ich könnte mir eine interessantere Gesellschaft vorstellen. Warum nicht Goethe oder Kant, meinem besten Freund oder andere Menschen? Nun ja, Goethe beispielsweise käme sicher nicht alleine mit, er brächte seinen „Faust“ in zwei Teilen mit, mindestens, und dann müssten wir uns die Insel zu viert teilen. Für den „Faust“ ist diese Insel aber viel zu klein.
Kant wiederum würde jede meiner Handlungen überdenken und sie mir nur dann erlauben, wenn sie als allgemeines Gesetzt gelten könnten. Thomas Hobbes würde mir ununterbrochen vorwerfen, dass der Mensch von Natur aus böse ist, in einem immerwährenden „Krieg aller gegen aller“ lebt – im ständigen Zwietracht mit Jean-Jacques Rousseau, der sagt, der Mensch sei von Natur aus gut und würde erst durch Gesellschaft schlecht und böse (also wäre ich auf der einsamen Insel ein ziemlich ideales Wesen).
Weil ich auf solche Auseinandersetzung keine Lust habe: Bleibt nur Schiller übrig. Was er geschrieben hat, kann ich immer wieder lesen, weil mich seine Texte in andere Welten ausführen. Sie erinnern mich daran, dass es mehr gibt als meine einsame und trostlose Insel. Schon allein in unserer Sprache steckt so viel mehr als eine Welt. Schiller schreibt in Versen, er lehrt mich, wie ich selbst meine eigene Sprache und viele andere Sprachen entwickeln kann. Und Schiller schreibt unterhaltsam. Mit ihm – wäre er persönlich dabei – hätte ich einen Gesprächspartner, der mich nicht mit Überlegungen zu Sachen zutexten würde, die mich auf meiner einsamen Insel nicht betreffen. Er würde anpacken, wo er gebraucht wird, weil er frei in seinen Handlungen wäre.
Daher habe ich den „Wilhelm Tell“ heute verwendet, um nach t 107 Tagen endlich ein Feuer anzuzünden. Ich bin gespannt, was „Die Räuber“ mit sich bringen.

"Schiller als Inselbegleiter" von Edin Cehic
Warum sollte man Schiller mitnehmen, ausgerechnet ihn, auf eine einsame Insel? In einer Welt, die täglich stärker an Komplexität, Geschwindigkeit und moralischer Erosion leidet, scheint diese Frage beinahe absurd. Und doch ist sie gerade deshalb dringlich. Denn was ist diese Insel, wenn nicht ein Bild für Isolation, Orientierungslosigkeit, für das Verlassen-Sein von Werten, von Gewissheiten, von Sprache gar? Thomas Mann hat 1955, in seiner späten Schiller-Rede, ein düsteres Zeitbild gezeichnet: die Menschheit „von Verdummung trunken“, taumelnd ihrem selbst verschuldeten Untergang entgegen, voller Wut, Angst, abergläubischem Hass, berauscht von Technik, Sport, Vernichtungsfantasien. Eine Welt, in der Bildung, Anstand, Treue, Gerechtigkeit und einfache Zuverlässigkeit schwinden,
in der das Humane regressiert.
Was tun gegen diese Schieflage? Wer nicht in ohnmächtiger Resignation verharren will, braucht einen Anker, einen Kontrast, einen Gesprächspartner. Und genau hier kommt Schiller
ins Spiel. Nicht als Heilsbringer, nicht als Ersatzreligion, nicht als Säulenheiliger der deutschen Klassik, sondern als kritischer Zeitgenosse, als Mahner, als Ideengeber. Denn Schiller hat nicht nur Werte formuliert, er hat sie durchdacht, durchlitten, durchdrungen.
Drei seiner zentralen Wertkomplexe sind es, die ihn zum Inselbegleiter qualifizieren. Selbstbestimmung ist der erste dieser Wertekomplexe. „Bestimme dich aus dir selbst“, das kantisch
inspirierte Ideal der Autonomie. Schillers Glaube an den vernünftigen, urteilsfähigen Menschen ist kein naiver Optimismus, sondern eine ethische Herausforderung: Denke selbst. Handle
selbst. Lass dich nicht verführen. In einer Welt voller Propaganda, Konformismus und digitaler Meinungsblasen ist das ein unbequemer, aber notwendiger Auftrag.
Der zweite dieser Wertekomplexe: Schillers Freiheitsbegriff. Freiheit ist nicht bloße Wahlmöglichkeit, sondern bewusste Entscheidung – selbst angesichts von Schuld, Verlust, Zwang, Bedrohung. Wer „frei sterben will“, muss nicht über die Umstände herrschen, sondern über sich selbst. Gerade heute, wo wir uns von Algorithmen, Trends und Krisen getrieben fühlen, ist diese Form der inneren Freiheit ein radikales, fast subversives Konzept.
Der dritte dieser Wertekomplexe: Treue, Zuverlässigkeit, Aufrichtigkeit, Freundschaft. Das sind keine leeren Phrasen, sondern soziale Mindestanforderungen. Nicht der Staat, nicht die Kirche, nicht das Kollektiv stiften bei Schiller Sinn, sondern jeder Einzelne in Beziehung zu anderen Einzelnen. „Die Bürgschaft“ ist ein eindrucksvolles Zeugnis dafür.
Dass Schiller auch missbraucht wurde, als Freiheitsdichter der Nazis, als nationaler Heilsverkünder, ist Teil seiner Rezeptionsgeschichte. Und doch zeigt gerade das: Seine Texte sind nicht eindeutig, nicht beliebig, aber offen. Seine Dramen sind keine dogmatischen Lehrstücke, sondern existenzielle Erfahrungsräume. Dass „Don Karlos“ 1937 in Berlin stürmischen Applaus für den Satz „Geben Sie Gedankenfreiheit“ erhielt, zeigt, dass Schiller immer wieder zu einer Stimme des Widerstands werden kann, auch gegen jene, die ihn missverstehen oder instrumentalisieren.
Schiller stellt Fragen, die auch heute niemand beantworten kann, ohne ins Straucheln zu geraten: Was ist Freiheit – und wie viel Verantwortung trägt sie mit sich? Wie weit darf Rebellion gehen – und wo beginnt die Zerstörung? Was bedeutet Gerechtigkeit – in einer Welt, die von Macht und Profit regiert wird?
In „Die Räuber“ etwa ist Karl Moor eine Figur zwischen Hoffnung und Verhängnis. Er kämpft gegen das Unrecht, doch wird selbst zum Täter. Seine Wut erinnert an heutige Protestbewegungen, seine moralischen Konflikte an jeden von uns. Und sein Scheitern ist eine Mahnung: Ideale brauchen Maß. Veränderung braucht Moral. Schiller zeigt die Kehrseite der Freiheit: Wenn sie ohne Werte gelebt wird, wird sie zur Gewalt. Wenn Franz Moor, sein machthungriger Bruder, sich durch Lüge und Manipulation an die Spitze setzt, sehen wir das Gesicht des entfesselten Egoismus – ein Spiegel des heutigen Turbokapitalismus, der Menschlichkeit und Zusammenhalt systematisch zersetzt. Auch das ist Schiller: unbequem, unbestechlich, unerschrocken.
Also: Warum Schiller auf die Insel mitnehmen? Weil er nicht beruhigt, sondern beunruhigt. Weil er nicht betäubt, sondern weckt. Weil er uns, auch heute noch, zur Freiheit ruft, zur Vernunft, zur Menschlichkeit. Und weil er zeigt, dass die Werte von gestern nur dann veraltet sind, wenn wir sie nicht mehr leben wollen.

"Mit Schiller im Team" von Lea Rimmer
Meine eigene Robinsonade. Ich, allein auf einer einsamen Insel, mit meinen Gedanken und – ich glaube es selbst nicht –: Schiller. Ausgerechnet Schiller, der für mich immer etwas Unnahbares, Einschüchterndes an sich hatte, ist mein ewiger Begleiter auf einer einsamen Insel?
Auf dieser Insel hat sich in mir ein neues Schiller-Bild geformt. Ich habe angefangen, ohne Erwartungen zu lesen und mich ganz auf die Texte einzulassen. Die Texte waren nicht mehr „der Schiller“, sondern mein Begleiter. Auf der Insel habe ich zunächst einfach nur gelesen und keine Unterschiede gemacht: Lyrik, Dramen, theoretischen Schriften und andere Prosa-Texte waren in meiner Ausgabe dabei. Dann las ich diese Texte immer wieder, bis ich Dialoge und Strophen mitsprechen konnte, alle Figuren kannte und in den Texten selbst weiterdenken konnte. Ich spürte das Rebellische, das Fordernde, das Hinterfragende in ihnen. Den Drang nach Freiheit, die Suche nach Gerechtigkeit, das Abrechnen mit der Gesellschaft – und doch konnte ich den Gedanken an meine Einsamkeit nie ganz loswerden. Wie liest man Schiller, wenn man keine Gesellschaft um sich herum hat?
Schillers Texte haben mich auch in der Einsamkeit bewegt, ihre Farben, Rhythmen und Klänge, ihre Emotionen und überraschenderweise auch der Humor, den ich in ihnen entdecken kann. „Schiller“ ist ein Gefühl, ein Verständnis, eine Weltansicht.
Ich könnte immer weiterlesen: von hinten nach vorne,, pro Seite nur ein Wort, Blackout-Poetry gestalten, Passagen vertauschen oder Enden umschreiben. Ich könnte die Seiten zu Origami falten oder die Texte für mich selbst aufführen. Und wenn ich einmal Abstand brauche, dann schließe ich die Bücher und wandere ans andere Ende der Insel.
Vielleicht sind Schiller und ich doch kein so schlechtes Team: zwei Rebellen auf einer Insel, mit viel Zeit zum Nachdenken und Sein. Die ein oder andere hitzige Debatte zu den Inhalten würde ich in meinem Kopf bestimmt mit Schiller führen, und doch wäre ich froh, nicht ganz allein auf der Insel zu sein.

"Persönlich antworten" von Svenja Trojan
„Als Grillanzünder!“, ruft J, als ich die Frage an sie weiterreichte und hoffte, eine angehende Lehrkraft im Fach Deutsch hätte eine bessere Antwort darauf, warum sie Schiller mit auf eine einsame Insel nehmen würde. Was genau Schiller ihr angetan hat, kann ich nicht sagen, allerdings ist sie so wütend, dass sie mit der flachen Hand auf den Tisch schlägt. „Nimm die gesamte Nationalausgabe mit! Du könntest damit Kokosnüsse vom Baum werfen, oder sie auseinanderreißen, dich damit zudecken und die Schnipsel stopfst du in ein Kissen.“
„Mit den Schnipseln kannst du dann auch puzzeln.“, schlägt M vor, die ebenfalls Deutsch auf Lehramt studiert. Ich bin schockiert, das nicht nur von der Aussage und der angedrohten Gewalt an Büchern, sondern auch davon, dass die beiden offensichtlich keine Ahnung haben, wie teuer das wäre.
Die Schiller Nationalausgabe besteht aus 43 Bänden (Teilbände nicht mitgerechnet), die zwischen 40€ und 100€ kosten. Das mit Abstand teuerste Puzzle, von dem ich je gehört habe. Ganz zu schweigen davon, dass ich mir den Hass zahlloser Mitarbeitenden, die an diesem 85 Jahre langen Projekt beteiligt waren, aufhalsen würde und vermutlich zu meinem eigenen Schutz für immer auf der Insel bleiben müsste.
Ich bin enttäuscht, dass die zwei keine bessere Antwort haben. Eine, in der keine Bücher verbrannt, zerrissen oder sonstwie zerstört werden, doch eigentlich bin ich es ja, die bisher noch gar keine Antwort auf die Frage gefunden hat.
Gar nicht, ist mein erster Gedanke. Ich würde Schiller gar nicht auf einsame Insel mitnehmen. Würde die Frage lauten „Fehlt dir Schiller?“, dann wäre sie jetzt zweifelsfrei geklärt. Tut sie aber nicht. Warum ich diese mentale Sperre gegenüber Schiller habe, kann ich nicht sagen. In der 7. Klasse haben wir „Wilhelm Tell“ gelesen, mit einem sehr engagierten Deutschlehrer, den wir alle mochten … also warum nicht auch Schiller? Immerhin scheine ich mit meiner Ansicht nicht allein zu sein, denn eine Schulfreundin antwortet mir auf die Frage nach der einsamen Insel: „Wer Schiller liest, verdient es auf einer einsamen Insel gestrandet zu sein.“ Auch sie trifft eine erschreckend drastische Aussage und ich frage mich, was die ganzen Schulklassen, die tagtäglich Gruppenfotos vor dem Goethe- und Schillerdenkmal in Weimar schießen, eigentlich von den beiden Dichtern halten. Und würden die dazugehörigen Lehrkräfte Schillers Werk auch am Strand zerreißen?
Ich versuche mein Glück deshalb lieber bei jemandem, der nicht auf Lehramt studiert und bekomme auch prompt eine viel literaturwissenschaftlichere Antwort, die auf Robinson Crusoe und Schiller selbst Bezug nimmt, als A vorschlägt, die Kannibalen auf seiner einsamen Insel Schillerdramen in verteilten Rollen lesen zu lassen und vom Theater als moralische Anstalt spricht.
Was gilt eigentlich überhaupt als einsame Insel? Napoleon wurde 1815 nach St. Helena verbannt, weil die Insel so isoliert war, dass es keine Möglichkeit zur Flucht gab. 2400 Kilometer weiter südlich liegt jedoch die abgelegenste bewohnte Insel der Welt, Tristan da Cunha. Dort leben zwar 259 Menschen, aber wenn eine Insel trotz Kannibalen als einsam gilt, warum nicht auch eine sehr abgelegene Insel mit Britinnen und Briten? Jedenfalls ließe sich mit Sicherheit leichter eine Theatergruppe organisieren.
Ein paar Tage später treffe ich mein nächstes „Opfer“ in der Institutsbibliothek. Es ist kurz vor Schließungszeit und wir sind allein, weshalb wir zwischen den Regalen auf dem Boden sitzen. T schlägt einen ganz anderen Ansatz vor und befragt Chat-GPT für mich. So weit ist es also schon gekommen, dass ich eine KI befragen (lasse), wie ich auf eine persönliche Frage antworten soll. Und die KI liefert natürlich sofort ab, aber nicht ohne uns zu erklären, dass die Frage „augenzwinkernd auf eine klassische Kulturfrage“ anspielt. Schließlich bezeichnet die KI das Ganze als „eine schöne Einladung zum Nachdenken über den Wert von Literatur, insbesondere von klassischer, anspruchsvoller Literatur, in Extremsituationen“. Dann schickt mir T die Screenshots und ich schleiche beschämt davon, weil ich immer noch keine Antwort gefunden habe, mit der ich glücklich bin.
Schreibe einen Kommentar
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.