

Zwei Wahrheiten und eine Lüge
von Lisa Hufschmidt
Luise Rinser im Archiv kennenzulernen erwies sich ähnlich einer Partie „Zwei Wahrheiten und eine Lüge“. Die Schriftstellerin war der Ehrlichkeit nicht immer treu, wobei zu spekulieren bleibt, ob sie nur andere oder auch sich selbst belogen hat.
Wie leicht Wahrheit und Lüge verschmelzen, ist Thema und Ergebnis der hier präsentierten Arbeiten. Auf Basis von zwei Wahrheiten – zwei Archivalien aus dem Bestand Rinsers – entstand eine Lüge, eine Vorstellung dessen, was hätte sein können, und eine Vorstellungen dessen, wie es hätte sein können. Beide so nah am Möglichen und doch fern von Wahrheit.
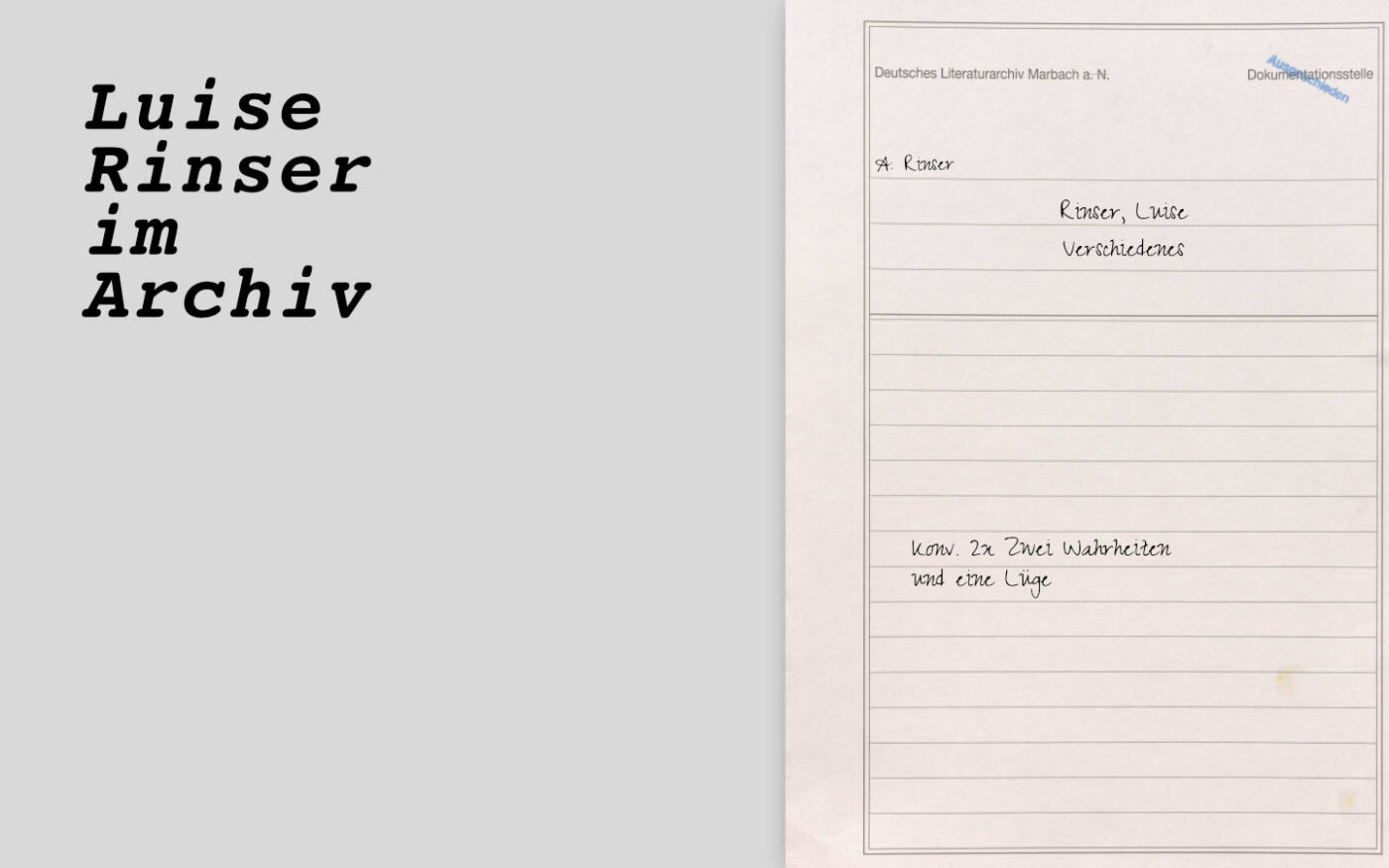

(Text 1) Betrachtung – Im Garten
Sie waren schon so lange gegangen, der knöcherne Arm des Gastgebers würde Abdrücke in ihrem fleischigen hinterlassen. Ein Abbild seiner erschreckend realen Zerbrechlichkeit, dass sie am Ende ihres Besuchs als trauriges Andenken mit nach Hause nehmen würde.
Stumm waren sie durch die alte, schlecht verglaste Tür geschritten, über die Schwelle gewankt, weil seine Beine weder ihn noch sie zu tragen vermochten. Auf der anderen Seite verharrten sie in einer standhaften Pause. Der pure Schein der Sonne stand in hartem Kontrast zu der trüben Färbung des Hauses, dessen samtblaue Vorhänge Licht und Laune herrlich froh verschlangen. Von rechts her hörte die Besucherin zarte Gardinen wehen, eine Brise kündigte sich an und kaum war deren Vorzeichen in ihr Bewusstsein gedrungen, streifte der schwüle Luftzug ihre fahle Haut und brachte Bewegung in ihr faltiges Gesicht.
Einem stummen Startschuss folgend begannen vier Füße Spuren im Blütenstaub zu hinterlassen, der das morsche Holz der Veranda überflutet hatte. Behutsam und mit einem Anflug von Unsicherheit, als wüsste das vierbeinige Wesen noch nicht, in welche Richtung es treiben würde, wankte es den vier Stufen am gegenüberliegenden Ende des von der Sonne ausgebleichten Holzes entgegen. Vielmehr dem, was die Besucherin gemeinhin als Stufen bezeichnet hätte. In den grünen Augen der romantischen Realität waren es nicht mehr als vier Steine. Zu groß, um von Menschenhand an Ort und Stelle gebracht worden zu sein, zu natürlich, für das Ergebnis maschineller Arbeit. Es erschloss sich ihr ganz plötzlich wie von selbst, dass alles, auf und zwischen dem sie hier wandelte, sein Zentrum in diesen vier unförmigen steinernen Stufen hatte. Als die beiden vor ihnen ankamen, nahm sie vorsichtig eine nach der anderen, langsam und mit Ehrfurcht, die sie das letzte Mal beim Gang zum Altar empfunden hatte, schritt sie voran, immer bedacht, ihre zerbrechliche Hälfte mit sich zu führen.
Die dünnen Schuhsohlen der Besucherin berührten Kies. Sie registrierte das dazugehörige knarschige Geräusch und im Hintergrund sein schweres Atmen. Seine Pause ließ ihr Raum, diesen Gang zu verarbeiten, ihn weit genug wegzuschieben, damit er beim Gehen nicht im Wege stand und doch gerade nah genug bei sich zu behalten, ihn auf dem Heimweg wieder hervorzuholen.
Rechts und Links begannen momentgleich den nächsten Schritt, das Knirschen des Kies’ wurde zu einem beruhigenden Begleiter und wie aus dem Nichts war da wieder das sanfte Lüftlein. Es tänzelte um ihre Nase und trieb mit aller Kraft den unwiderstehlichen Duft der Rosenblüten hinein, die weit und breit nicht zu sehen waren. Sie konnte den Blick noch so sehr drehen und wenden, alles was ihr entgegen sah, war eine bezaubernde Varianz von Grün, das im satten Widerspruch zu dem hellen Kies stand, von dem die Sonne in Flecken reflektierte. Die Augen der Besucherin verengten sich zu kneifenden Schlitzen. Am liebsten hätte sie sich einfach der geschlossenen Schwärze hingegeben. Sie war sich sicher, er könne sie blind durch den Garten führen, er kannte jedes noch so entfernte Eck, jede noch so unscheinbare Schattierung von Grün und er musste wissen, wo der Ursprung des Rosendufts war, der ihre Nase bereits wieder verlassen hatte. Doch statt ihre Lider zu senken, richtete sie ihren aufgerissenen Blick auf den Gastgeber. Die bübischen Mundwinkel hatten sein ledernes Gesicht noch immer nicht verlassen, seit ihrer Ankunft, womöglich und wahrscheinlich schon seit lange vor ihrer Ankunft, ihrer Bekanntschaft, hatte er sich diesen Ausdruck ins Gesicht geschrieben. Er faszinierte sie, fesselte sie und machte es schwer, den Blick zurück auf den schimmernden Weg zu richten. Doch sie war nicht alleine hier, sie war Teil der verschwiegenen Zweisamkeit und als solcher musste sie nach vorn sehen.
Die Luft um das vierarmige Wesen, das knirschend durch zu viel Grün lief, war inzwischen zu einer Wand verkommen. Kein Lüftchen regte sich, kein Düftchen wurde an sie herangetragen. Es schien, als wäre die Luft in Ehrfurcht derer erstarrt, die sich so selbstverständlich durch sie hindurch bewegten. Bienen, Pollen, zarte Schmetterlinge und blätterne Baumgrüße schwebten unbeschwert durch die himmelhohe Mauer hindurch, als würden sie einen längst vergessenen Zaubertrick vollführen. Sie gehörten nicht zu diesen Eingeweihten, bewegten sich, im Gegenteil, als wären sie voneinander beschwert.
Der unerwartete Wechsel zu Gras ließ sie stolpern und sehen. Es ergab sich der Anschein, als würde er, als würde die Welt des Gartens sich einen Scherz mit ihr erlauben. Stand sie gerade noch in Grün auf Weiß, fand sie sich nun in Weiß auf Grün. Der Überhand gewinnende Duft der Rosen erschütterte ihr Gemüt, das Weiß wich einem Schwarz und nun drückte sich ihr fleischiger Unterarm in seinen Knöchernen. Als sie die Augen wie auf sein Zeichen, ein vages Schmunzeln, bei dem sich seine Seite gegen ihren Arm erhob, wieder öffnete, erkannte sie die steinerne Bank inmitten der Rosen. Wie ein Monument erstieg sie aus saftigem Grün, das bereits begonnen hatte, sie in sich aufzunehmen. Der Stein versprach Kühle, die er nicht halten konnte, und den Moment der Rast, nach dem sich ihrer beider Hälften sehnten. Es waren nur ein paar Schritte zu gehen und doch bedurfte es einer Anstrengung, als würden sie die zeitalte, vierstufige Steintreppe errichten, zu dem Grauen Sitz zu gelangen. Langsam, wie sie gekommen waren, nahmen sie Platz und lösten sich voneinander. Der Stein war von der Sonne heiß geworden, die Besucherin verbrannte sich beinahe die raue Handinnenfläche, bei dem Versuch sie darauf abzulegen. “Nun Frau Rinser, sollten wir etwas schweigen,” drang die dunkle Stimme des Gastgebers durch das Bienensummen und Vogelzwitschern an ihr Ohr. Sein Blick war voll verlorener Gedanken in den grünen Gang mit den weißen Kieskacheln gerichtet, den sie entlang geschritten waren, als läge etwas darin, dass sie verstehen sollte. Sie folgte dem faden Grün seiner Augen in Richtung Vergangenheit und begann, ohne Widerworte zu schweigen.

(Text 2) Tagebucheintrag – Im Café
Die Tasse vor mir sagt billig, obwohl sie eindeutig teuer schreien soll. Die Wände sind dünn, aber nicht zierlich, die fliederfarbenen Verzierungen sind fein, aber nicht zierlich, nicht teuer. Die Tasse ist ein bestenfalls mittelmäßiges Imitat und erinnert mich an meine zukünftige Schwiegermutter, auf deren Sohn ich warte. So unzufriedenstellend wie das Tassenimitat scheint mir dessen Inhalt, Kaffee sollte es sein, schwarz, aber er ist braun und schmeckt nach Tee.
Gespräch mit dem Kellner:
“Haben Sie Kaffee mit Tee verwechselt?”
“Nein die Dame, ich habe Ihnen einen schwarzen Kaffee gebracht, wie gewünscht.”
“Sind Sie sich sicher, dass Ihnen kein Fehler unterlaufen ist?”
“Ja Madame, es ist Kaffee, wie gewünscht.”
Von ‘wie gewünscht’ kann aber nicht die Rede sein. Ich bezweifle, dass der Kellner die Wahrheit sagt, auch wenn er nicht lügt, ich nehme stattdessen an, er ist sich des Fehlers schlicht nicht bewusst.
Während ich nun also weiter auf meinen baldigen Ehemann warte, rennen Kellner, auch mein Fehlerhafter, an mir vorbei und wirken vom Leben gebeutelt – darin ähneln sie mir – ihm aber nicht überdrüssig – darin unterscheiden wir uns. Früher, vor der eisernen Zeit, war ich wie sie gewesen, dem Überdruß fern, aber so bin ich schon lange nicht mehr.
Ich sehe aus dem Fenster, um nicht länger die Kellner anzustarren und sehe nicht, wie zu erhoffen gewesen wäre, meinen heran eilenden Zukünftigen. Er verspätet sich mal wieder, hängt wahrscheinlich in seinen Noten fest, es kann noch Stunden dauern, bis ich ihn zu Gesicht bekomme. Nein, ihn sehe ich nicht, stattdessen eine Überzahl an Frauen die von links nach rechts und von rechts nach links gehen, einige bleiben vor dem Café stehen und blicken hinein, andere bleiben stehen und unterhalten sich mit einer Bekannten und wieder andere, rempeln sich an, weil sie mehr in ihrer eigenen als der realen Welt umhereilen. Ich beobachte also das Treiben der Femininen und komme nicht umhin mich zu fragen, würde ich zwischen ihnen gehen, wäre ich eine von ihnen oder wäre ich ein Fremdkörper. Ich bin natürlich eine Frau, von Natur aus, man sieht es mir an. Aber wie weiblich hat mich das Gefängnis tatsächlich hinterlassen? Auf diesen düsteren Quadratmetern treiben sie dir alles aus, die Frauen und Männer vor den Gittern und auch die hinter den Gittern, sie nehmen dir deine Individualität, deinen Intellekt und noch die letzte Sicherheit deines Körpers, ist das noch dein Körper? Meiner hat noch alles, was zu einer Standardfrau dazu gehört, aber reicht das? Muss ich mich nicht auch fühlen, wie eine Frau und wie fühlt sich das eigentlich an?
Der Lärm frisch polierter Lackschuhe reißt mich dankenswerter Weise aus meiner Gedankenspirale, edle Lackschuhe, tatsächlich teuer, nicht wie die Schwiegermutter.
Gespräch mit dem Kellner:
“Möchten Sie noch einen Kaffee?”
“Auf gar keinen Fall. Wein. Weiß und trocken. Grüner Veltliner.”
“Sicher.”
Während die Lackschuhe mir schon den Rücken zuwenden, korrigiere ich laut auf zwei Gläser, denn nun sehe ich zwischen all den Frauen vor dem Fenster einen Mann, den, auf den ich warte. Er eilt durch den schweren, roten Samtvorhang ins Café, schon ohne ihn zu sehen, weiß ich um den Schweiß unter seiner Hutkrempe und sehe den kleinen Strauß in seiner tintenbefleckten Hand. Er sagt, die Blumen seien der Grund seiner Verspätung, ich weiß es besser, aber das stört mich nicht. Ich nehme den kleinen Strauß entgegen und bemerke die verdächtige Ähnlichkeit meines floralen Geschenks mit dem Blumenbouquet auf den Marmortischen vor dem Café, auch das stört mich nicht. Ich schmunzle, sehe aus dem Fenster und entdecke den Tisch mit der leeren Vase. Ein letztes Mal beobachte ich die Damen vor dem Fenster und stelle fest, es ist mir egal, wie weiblich ich mich fühle, ich fühle mich menschlich und das konnte mir nicht einmal das schmutzige Gefängnis austreiben.
Schreibe einen Kommentar
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.